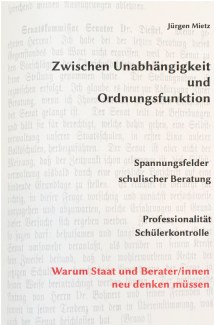Versuch einer Illustrierung
Die Entwicklung schulischer Inklusion in Hamburg kann zum Teil als Illustrierung des im vorangehenden Beitrag (über Keupp) dargestellten Verlusts des »Selbst der Psychologie«, des Verlusts an Empathie und der Ausbreitung von »Gesellschaftsblindheit« (»soziale Amnesie«)gesehen werden.
Inklusion ist das dominierende Projekt der Politik. Mit ihm sollen alle Gebrechen einer exkludierenden Gesellschaft geheilt werden (siehe auch diesen Beitrag). Unter Verkennung der menschlichen und psychologischen Anforderungen, die ein solches Unternehmen der Zu(sammen)gehörigkeit in Verschiedenheit erfordert, werden Verfahren entwickelt, die mit großem Aufwand Abgrenzungen, Ausgrenzungen und Etikettierungen produzieren, wie man aktuell in der taz lesen kann.
Beratung ist vor und nach dem Test
Angehörige von Abteilungen, die das Wort „Beratung“ in ihrer Bezeichnung führen, sind wesentlich damit beschäftigt, begutachtend, steuernd und kontrollierend tätig zu sein. Sie stellen den Förderbedarf so genannter „Inklusionskinder“ fest. Beratung wird hier offensichtlich als Verarbeitung dessen verstanden, was vor oder nach der Testdiagnostik stattfindet. Was bleibt, ist, dass „Beratung“ über den Test, eine kommende oder gewesene Prüfung definiert ist. Mit dieser Art der Feststellungsdiagnostik sind wir wieder in der Etikettierungsmaschinerie der 60 er und 70 er Jahre des vergangenen Jahrhunderts angekommen. (Bei angehenden Lehrer’inne’n geht man übrigens — zurecht — davon aus, dass eine Eignung für ein Lehramt testdiagnostisch nicht zu vertreten ist. So die Empfehlungen der Expertenkommission zur Reform der Lehrerbildung).
Weiterlesen „Der Verlust des Selbst der Psychologie II“